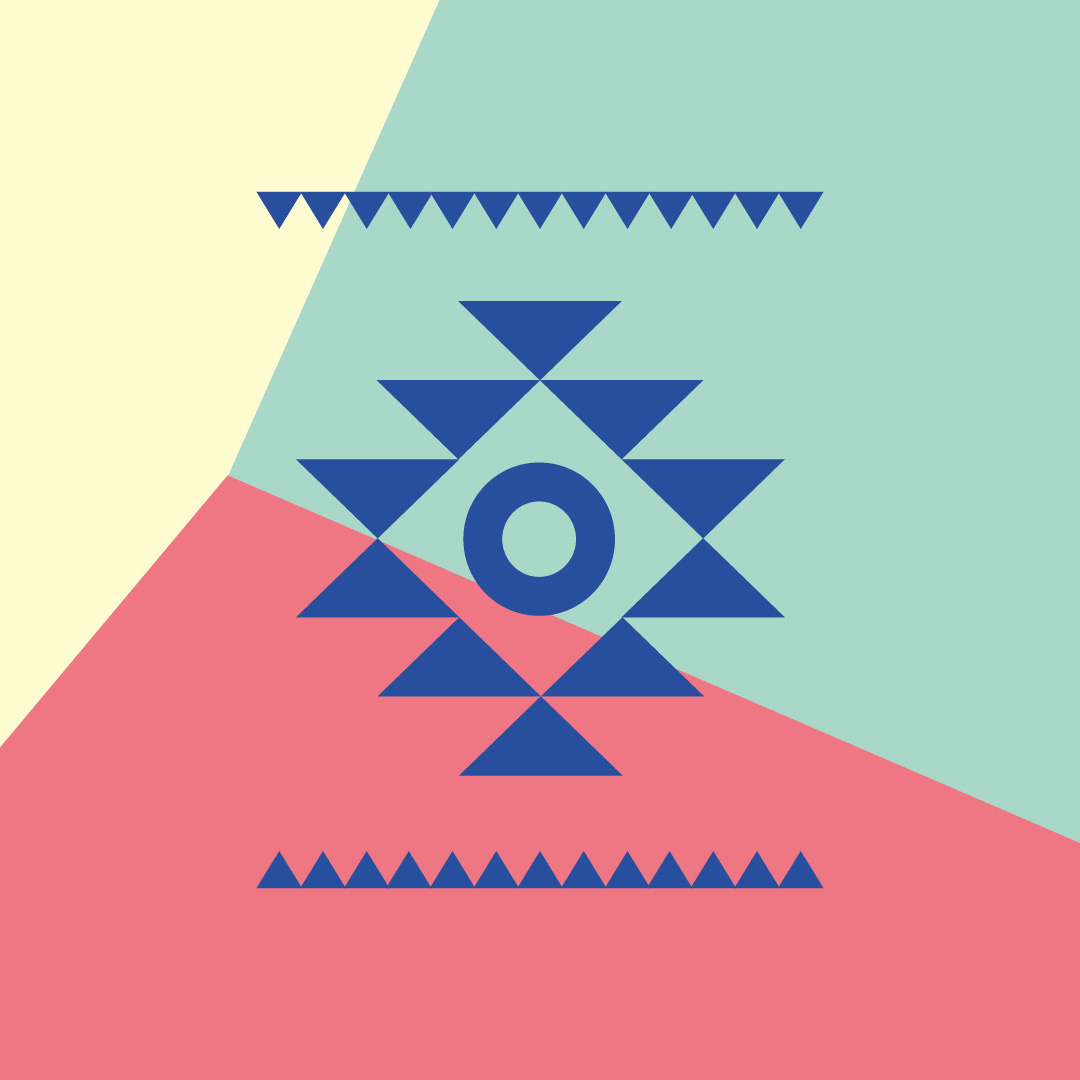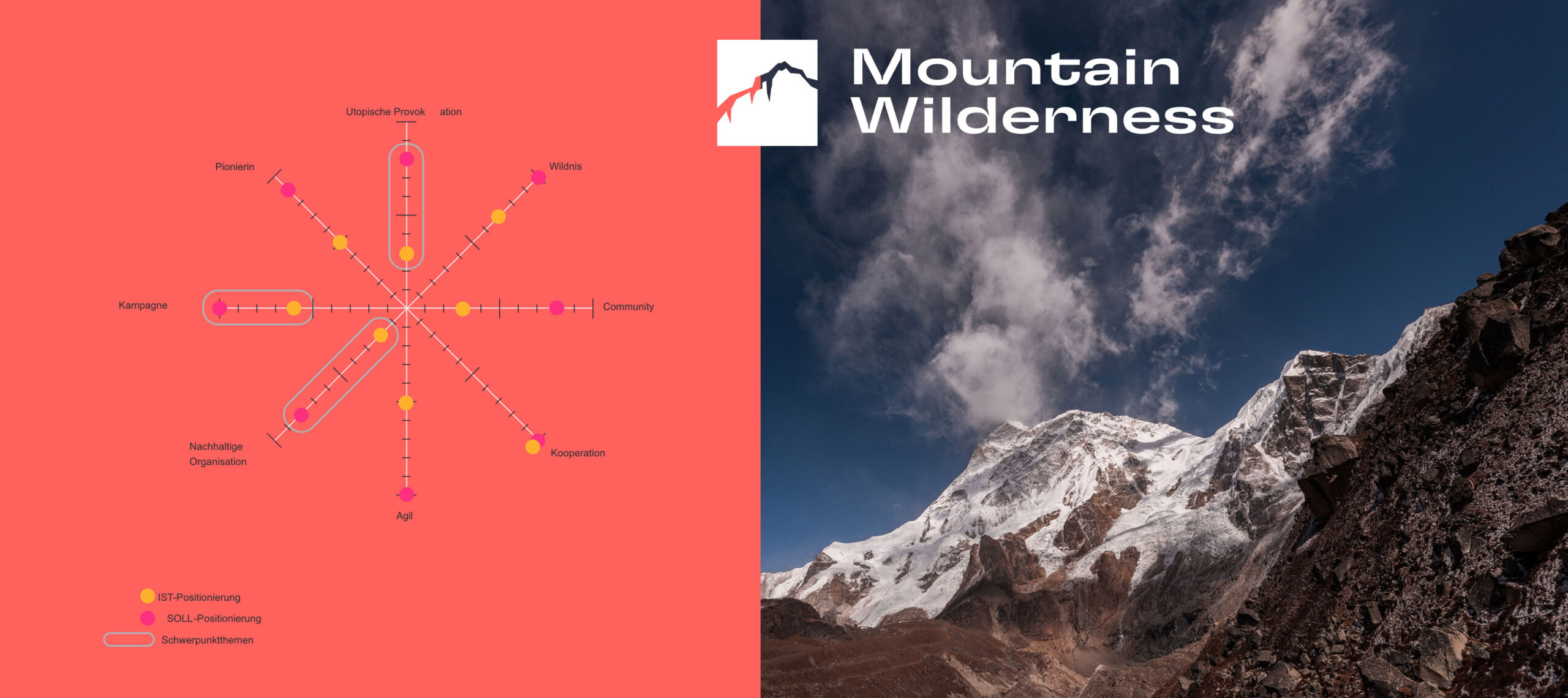
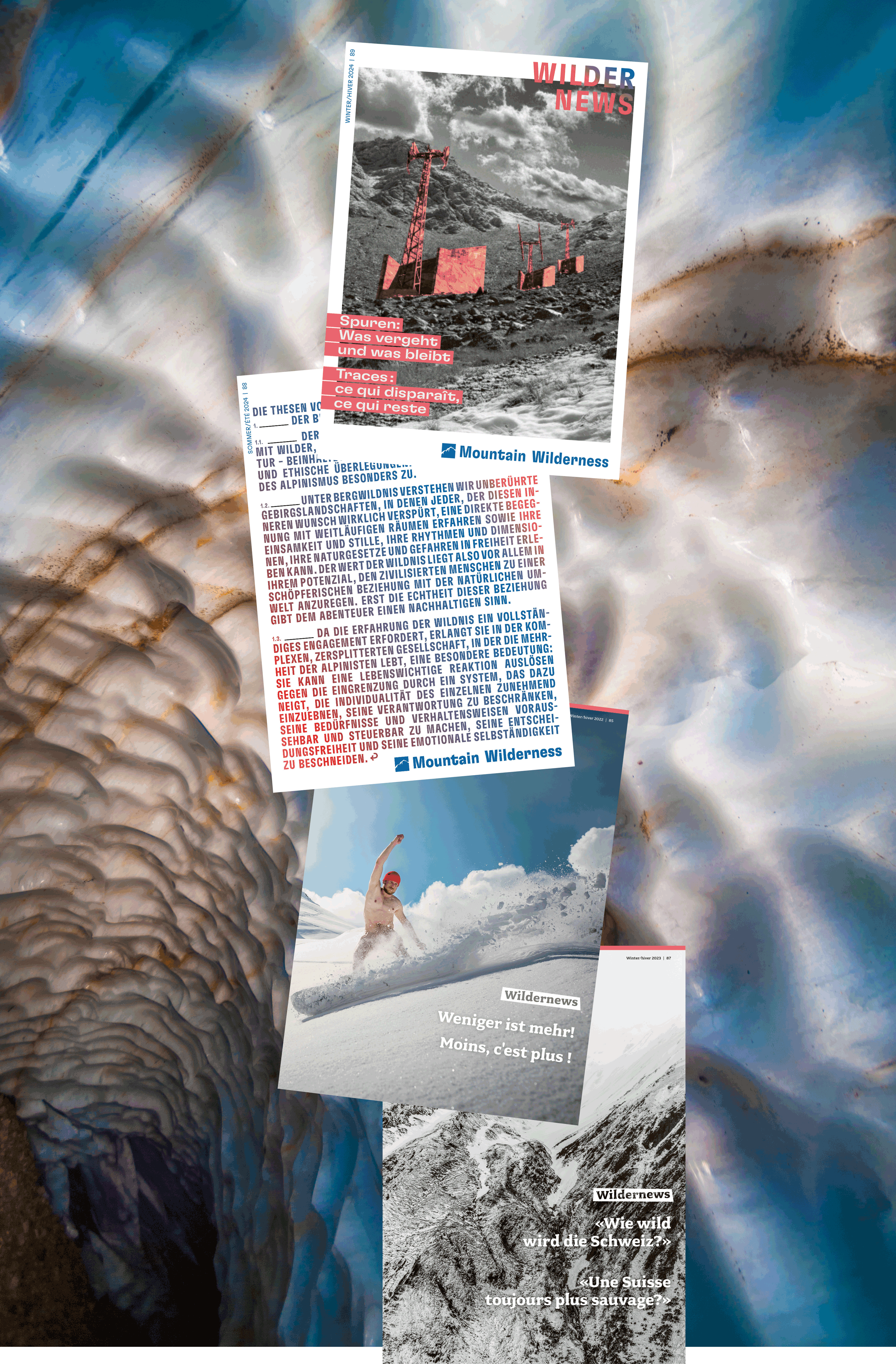
Die Thesen von Biella
1.1 Der Begriff der Wilderness – Übersetzbar mit wilder, vom Menschen nicht umgestaltete Natur – beinhaltet notwendigerweise psychologische und ethische Überlegungen. Das trifft im Bereich des Alpinismus besonders zu.
Manifest weiterlesen …
- 1.2. Unter Bergwildnis verstehen wir unberührte Gebirgslandschaften, in denen jeder, der diesen inneren Wunsch wirklich verspürt, eine direkte Begegnung mit weitläufigen Räumen erfahren sowie ihre Einsamkeit und Stille, ihre Rhythmen und Dimensionen, ihre Naturgesetze und Gefahren in Freiheit erleben kann. Der Wert der Wildnis liegt also vor allem in ihrem Potenzial, den zivilisierten Menschen zu einer schöpferischen Beziehung mit der natürlichen Umwelt anzuregen. Erst die Echtheit dieser Beziehung gibt dem Abenteuer einen nachhaltigen Sinn.
- 1.3. Da die Erfahrung der Wildnis ein vollständiges Engagement erfordert, erlangt sie in der komplexen, zersplitterten Gesellschaft, in der die Mehrheit der Alpinisten lebt, eine besondere Bedeutung: Sie kann eine lebenswichtige Reaktion auslösen gegen die Eingrenzung durch ein System, das dazu neigt, die Individualität des Einzelnen zunehmend einzuebnen, seine Verantwortung zu beschränken, seine Bedürfnisse und Verhaltensweisen voraussehbar und steuerbar zu machen, seine Entscheidungsfreiheit und seine emotionale Selbständigkeit zu beschneiden.
- 1.4. Infolgedessen ist von grundlegender Wichtigkeit, dass wir uns bewusst werden, wie vielfältig die ökologischen Werte mit ethischen und ästhetischen Werten und Verhaltensweisen verflochten sind. Die Bedeutung des Bergsteigens als kulturellen Ausdruck liegt in genau diesen Zusammenhängen.
- 2. Zerstörung der Wildnis. Verantwortung
- 2.1. Die Gemeinschaft der Bergsteiger und die sie vertretenden Organisationen tragen, historisch gesehen, eine ganz klare Verantwortung bei der Zerstörung der Bergwildnis, im Alpenraum wie in der übrigen Welt. Diese Verantwortung ist, obwohl sie in den meisten Fällen indirekt oder unbeabsichtigt war, nicht minder zu verurteilen. Gleichgültigkeit, Indifferenz und Ignoranz sind keine Entschuldigung.
- 2.2. Der Wunsch, durch einen erleichterten Zugang möglichst viele Menschen zum Bergsport zu bewegen, ist theoretisch verständlich, hat letztlich jedoch oft zu einer schädlichen Übernutzung geführt. Um die daraus entstandene, steigende Nachfrage zu befriedigen, wurden neue Hütten erstellt, bestehende erweitert, Klettersteige installiert und weitere Konsumanreize geschaffen. Doch diese Politik beinhaltet gravierende Fehleinschätzungen.
- Sie übersieht dass die Wildnis und die ihr innewohnende Einsamkeit einen unverzichtbaren Kern des Bergsteigens bilden. Wir sind der Überzeugung, dass sich Planung und Größe der Berghütten nicht nach der Nachfrage möglicher Besucher zu richten haben, sondern sich an der Zahl der Menschen orientieren müssen, die eine natürliche Landschaft (die durch solche Hütten erschlossen wird) ohne Einbuße an Erlebniswert verkraften kann. Auch sollten Berghütten und feste Biwaks auf keinen Fall entlang von Aufstiegsrouten, in Gipfelnähe oder an Lagen gebaut werden, wo sie die wilde Großartigkeit einer Landschaft beeinträchtigen können.
- 2.3. Die Bergwildnis wird auch durch das Eindringen mechanischer Aufstiegshilfen empfindlich gestört. Die Gemeinschaft der Bergsteiger unterstreicht mit Nachdruck ihre Aversion gegen die unkontrollierte Ausbreitung des Pistenskilaufs, seiner massiven und spekulativen Infrastruktur und der kulturellen Armut seiner Angebote. Der Wintersport muss auf nationaler wie auf internationaler Ebene dringend strengen Regelungen unterworfen werden. Der Einsatz von Helikoptern und Flugzeugen zum Absetzen der Touristen und Skifahrer im Hochgebirge muss verboten werden; ebenso der Bau neuer Seilbahnen, die über Berggipfel, Einsattelungen oder Gletscher hinweg Täler verbinden oder sonst wie den landschaftlichen Reiz und die alpinistische Ernsthaftigkeit einer Gegend beeinträchtigen.
- 2.4. Selbst Eingriffe, die aus streng ökologisch-landschaftlicher Sicht nur einen geringfügigen Schaden zufügen, können sich als folgenschwer erweisen, da sie das Erlebnispotential verfälschen oder vermindern. Eine Linie zurückgelassener Fixseile kann einer Wand bereits ihren ganzen Zauber nehmen. Außerdem breiten sich zusehends Einstellungen gegenüber dem Gebirge aus, die zwar keinen unmittelbaren ökologischen Schaden anrichten, aber durch ihren vorwiegend konsum- und sensationsorientierten Charakter zweifelhafte Botschaften aussenden und eine Mentalität fördern, für die das Gebirge bloße Staffage für sportliche Freizeitbeschäftigungen ist.
- 2.5. Wir müssen uns allmählich die Frage stellen, ob die Wildnis nicht auch bedroht wird durch die Verbreitung allzu ausführlicher Routenbeschreibungen und Tourenführer, da diese die Möglichkeit des selbständigen Entdeckens und die daraus entstehenden, wertvollen Erlebnisse stark einschränken.
- 2.6. Der Leichtsinn des Gewissens ist weniger sichtbar als die Verschmutzung durch Abfälle, deswegen jedoch nicht minder schädlich. Insbesondere jene Bergsteiger, die durch ihre Taten großes Ansehen genießen, tragen deshalb eine große Verantwortung. Ihr Verhalten wird nachgeahmt, ihrem Beispiel wird gefolgt. Es ist somit unsinnig, über den erzieherischen Wert des Bergabenteuers zu predigen oder Petitionen zum Schutz der Wildnis zu unterzeichnen, um sich dann inkonsequent zu verhalten, wenn es um den eigenen Erfolg, den Wettkampf oder andere sportliche oder wirtschaftliche Interessen geht. Kein Bergsteiger darf sich das Recht nehmen, von außen über die innerlichen Beweggründe eines anderen Bergsteigers zu urteilen, oder freie Spielregeln zu moralischen Grenzen umdeuten und damit fremde Entscheidungen kritisieren. Aber es ist allzu offensichtlich, dass unsere Glaubwürdigkeit bei der Verteidigung der Bergwelt gänzlich von der Aufrichtigkeit eines jeden Einzelnen abhängt.
- 2.7. Leider ist diese Konsequenz bei vielen Expeditionen in den Himalaja und in die Anden bis heute nicht vorhanden. Die Verantwortung für die heutige Zerstörung der Wildnis dieser außerordentlichen Gegenden tragen ausschließlich die Bergsteiger. Genauer: die besten Bergsteiger. Es obliegt somit der Gemeinschaft der Bergsteiger, einen strengen Verhaltenskodex zu formulieren und dafür zu sorgen, dass er tatsächlich auch eingehalten wird.
- 2.8. In diesem Zusammenhang ist das Zurücklassen von Hochlagern und Fixseilen, aber auch das Zurücklassen oder Vergraben von Abfällen ein schweres Vergehen. Selbst wenn man durch eine Notlage dazu gezwungen wird, sollte alles unternommen werden, um hinterher jede Spur des eigenen Besuchs zu beseitigen.
- 2.9. In wasserarmen Gebirgen, und in jedem Falle oberhalb der letzten menschlichen Siedlungen, müssen Expeditionen auf die Verwendung von vor Ort gesammeltem Brennholz verzichten. Der häufige Durchzug zahlreicher Expeditionen führt zur Verödung der Hochtäler und zur Zerstörung der kostbaren, unglaublich langsam gewachsenen Vegetationsdecke. Ein einziges Abendessen kann das Ende bedeuten für Dutzende niedrige, aber oft jahrhundertealte Büsche.
- 3. Wildnis und Bergvölker
- 3.1. Das wiederholte Durchziehen von Expeditionen, gefolgt vom ständigen Strom von Trekkern, verursachen derzeit tief greifende Veränderungen im Leben der lokalen Bevölkerung, in ihrem materiellen Wohlergehen, in ihren Werthaltungen, in ihrer gesellschaftlichen Struktur und in ihrer traditionellen Kultur. Es ist schwierig abzuschätzen, wie weit sich diese Veränderung positiv oder negativ auswirken, da sich selbst Experten darüber nicht einig sind. Es erscheint jedoch vernünftig anzunehmen, dass die plötzliche Zufuhr von Geld und materiellen Gütern – zu denen die Jungen mehr Zugang als die Alten haben – eine destabilisierende Wirkung haben kann, indem sie typisch »westliche« Werte in Gesellschaften hineinbringt, die nicht darauf vorbereitet sind, damit umzugehen. Anderseits kann die Aufgabe traditioneller Arbeitsbereiche und die Ausrichtung auf diese neuen Arbeitsfelder und Geldquellen die lokale Bevölkerung in eine Krise stürzen, falls die Expeditionen plötzlich ausbleiben sollten – was jederzeit möglich ist. Dazu kommen die dürftigen historisch-anthropologischen Kenntnisse der meisten Alpinisten und die daraus entstehende Mühe, ihre eigenen westlichen Urteile zu überwinden und die kulturellen Unterschiede auch dort zu akzeptieren, wo sie unverständlich scheinen. Es ist sehr zu hoffen, dass sich die Diskussion um solche Fragen ausweiten und an Tiefe gewinnen kann. Niemand darf gleichgültig bleiben angesichts der Ungewissheit, ob sein Verhalten die ethische, soziale und kulturelle Verelendung anderer Menschen verursachen kann oder ihr Leben gar – leichtsinnig – gefährdet.
- 3.2. Die Beziehungen zwischen dem Alpinismus und der Bergbevölkerung sind zu komplex, um hier glaubwürdig und vollständig abgehandelt zu werden. Diese Probleme sind jedoch konkret; die Gemeinschaft der Bergsteiger muss sich dazu stellen.
- 4. Strategie
- 4.1. Es wäre falsch zu behaupten, Bergsteiger und alpine Vereine hätten bisher nichts für den Erhalt der Bergwildnis unternommen. Doch diese Initiativen haben nur sehr begrenzte praktische Wirkung gezeitigt.
- 4.2. Die Zeit ist reif, um einen Schritt nach vorn zu machen. Bergsteiger aus aller Welt, versammelt zur Mountain-Wilderness-Konferenz in Biella, wollen eine organisierte Bewegung neuer Art schaffen, die mutige, unkonventionelle und wirksame Strategien zum Schutz der letzten unberührten Räume der Erde verfolgen soll – mit konkreten Aktionen und auch utopistischen Provokationen als wichtige und regelmäßige Bestandteile dieser Strategien, um das ökologische Bewusstsein immer weiterer Kreise von Bergbesuchern zu stärken.
- 4.3. Diese in Biella geborene Bewegung wird »MOUNTAIN WILDERNESS« genannt und hat internationalen Charakter. Ihr Hauptsitz wird sich für die Zweijahresperiode 1988/89 in Italien befinden. Die Konferenz hat 21 Garanten gewählt mit dem Auftrag, Statuten zu entwerfen und die Bewegung juristisch zu gründen, die für eine Handlungsfähigkeit nötigen Verantwortlichen zu ernennen, und auf die Verwirklichung der Ziele hin zu arbeiten. Die 21 Garanten sind für zwei Jahre gewählt.
- 5. Kurzfristige und mittelfristige Ziele der Bewegung »MOUNTAIN WILDERNESS«
- 5.1. Die Bewegung wird auf die alpinen Vereine und Naturschutzorganisationen in den verschiedenen Ländern einwirken, um:
- a) eine Erneuerung der Kultur des Bergsteigens im Sinne der Wildnis zu fördern (gegen die Kommerzialisierung, gegen die ungebremste Vermassung, für die Sensibilisierung der Jugend in der Schule, für die Entwicklung eines Umweltbewusstseins bei Bergführern, Bergsportlehrern und Trekkingleitern),
- b) die genannte Vereine zu intensiverer und effektiverer Umweltpolitik anzuregen; und einzugreifen, falls sie Pläne unterstützen oder zulassen, die gegen den Geist der Wildnis verstoßen.
- a) eine Erneuerung der Kultur des Bergsteigens im Sinne der Wildnis zu fördern (gegen die Kommerzialisierung, gegen die ungebremste Vermassung, für die Sensibilisierung der Jugend in der Schule, für die Entwicklung eines Umweltbewusstseins bei Bergführern, Bergsportlehrern und Trekkingleitern),
- 5.2. Die Haupttätigkeit der Bewegung wird darin bestehen, Vorschläge zu formulieren und Anstöße zu geben, wie:
- a) Konzepte erarbeiten, Machbarkeit untersuchen und Vorschläge unterbreiten zur Errichtung von Parks und/oder Schutzzonen in Bergregionen, deren Wildnis noch geschützt oder wiederhergestellt werden kann (Internationaler Park Montblanc, Nationalpark Hohe Tauern, verschiedene noch intakte Gebiete in den Dolomiten);
- b) das außeralpine Bergsteigen im alpinen Stil fördern (leichte und ultraleichte Expeditionen); die lokalen Regierungen zu scharfen Maßnahmen ermuntern gegen Expeditionen und Trekkings, die sich unkorrekt verhalten, mit besonderem Augenmerk auf die Verpflichtung, Abfälle nur an vorgegebenen Stellen zu deponieren.
- 5.3. Die Bewegung wird in ihrer ständigen Tätigkeit auch Aktionen mit hohem Symbolgehalt berücksichtigen, wie:
- a) feste technische Einrichtungen beseitigen oder bekämpfen, die mit der Wildnis nicht vereinbar sind, wie die Seilbahnen der Vallée Blanche, die Skirunde am Pelmo, die Anlagen auf dem Glacier de Chavière, die Tourismuseinrichtungen am Salève, Klettersteige usw.
- b) eine Expedition anregen, die sich die Wiederherstellung eines verschandelten Gebiets zum Ziel setzt (South Col am Everest, Sperone degli Abruzzi am K2 usw.)
- 5.4. Die Bewegung wird sich bemühen, Regierungen und internationale Organisationen stets über den Stand ihrer Initiativen zu informieren. Insbesondere wird sie die Regierungen und regionale Behörden angehen, um durch geeignete Maßnahmen und Kontrollmöglichkeiten eine strikte Reglementierung des Einsatzes mechanischer Transportmittel im Gebirge zu erreichen (Flugzeuge und Helikopter, Offroad und Motocross, Motorschlitten, Ultraleicht-Flugzeuge).
- 6. Schluss
- 6.1. Der Schutz der Wildnis ist heute dringlicher denn je. Aus diesem Grund hat sich die Konferenz von Biella konkrete und kurzfristige Ziele gesetzt. Aber diese Begegnung hat auch ein neues Bewusstsein ausgelöst: Der Schutz der Bergwelt ist lediglich ein Aspekt der Erhaltung der weltweiten Wildnis. Wir müssen deshalb die Kräfte bündeln mit allen Organisationen, die sich auf diesem Planeten dem Schutz der Wüsten, der Meere, der Urwälder, der Gebirge und der Eisschilder verschrieben haben. Dieser Schutz verlangt auch die Ächtung von zerstörerischen militärischen Übungen, von Atomtests und von der Lagerung radioaktiver Abfälle. Die Berge gehören noch zu den ursprünglichen Orten der Erde und damit zum kostbaren Erbe aller Menschen.


«Als stets kompetenter und verlässlicher Partner unterstützt uns Magma in den Bereichen Web & Print sowie bei der Markengestaltung. Ohne sie wäre unser Leben nur halb so schön.»
Juerg Haener
Verantwortlicher für Kommunikation
Mountain Wilderness Schweiz



Unerschlossene Berglandschaften sind von unschätzbarem Wert. Mountain Wilderness engagiert sich für eine wildnisfreundliche Entwicklung der Alpen und einen umweltverträglichen Bergsport.
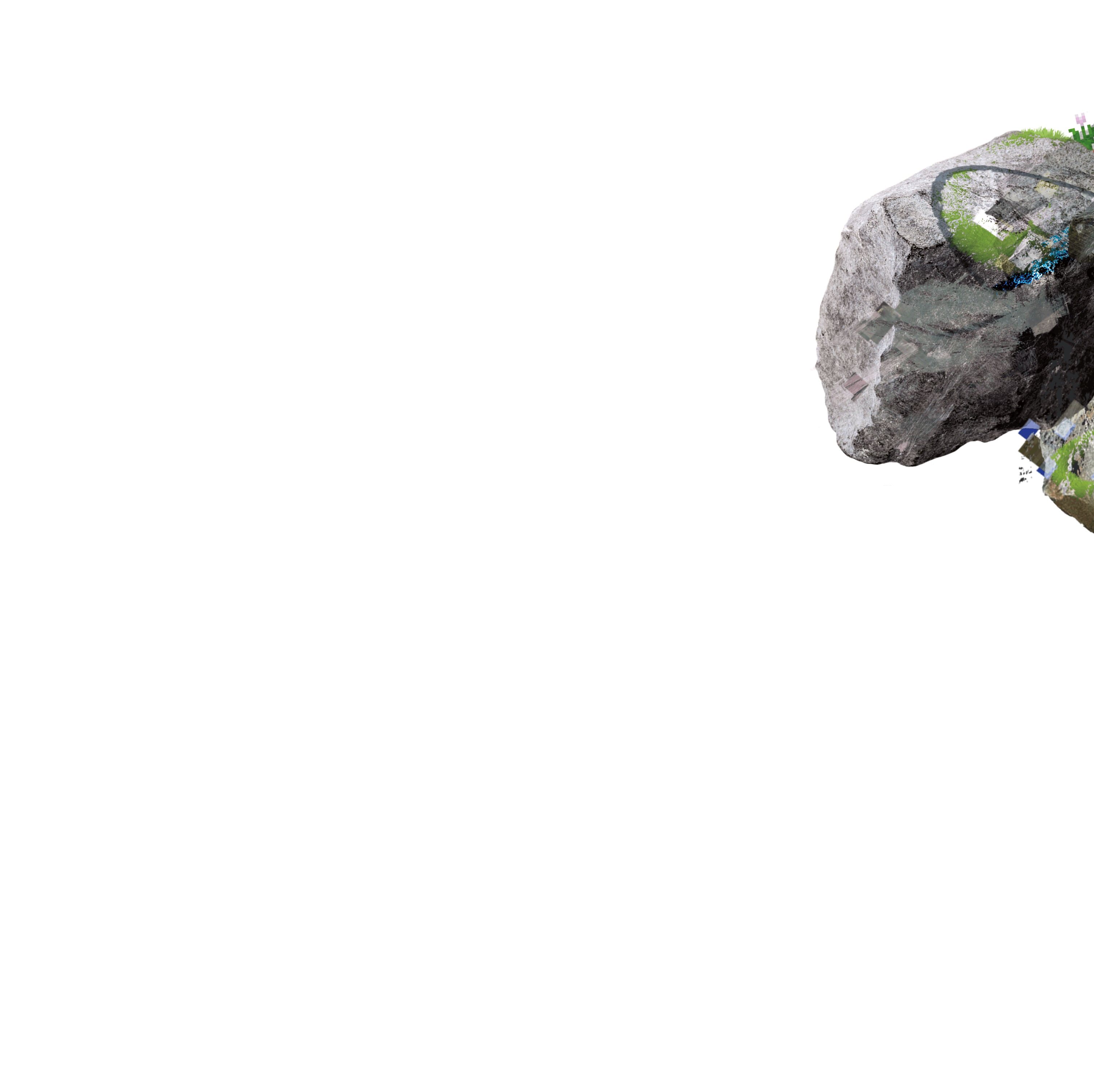
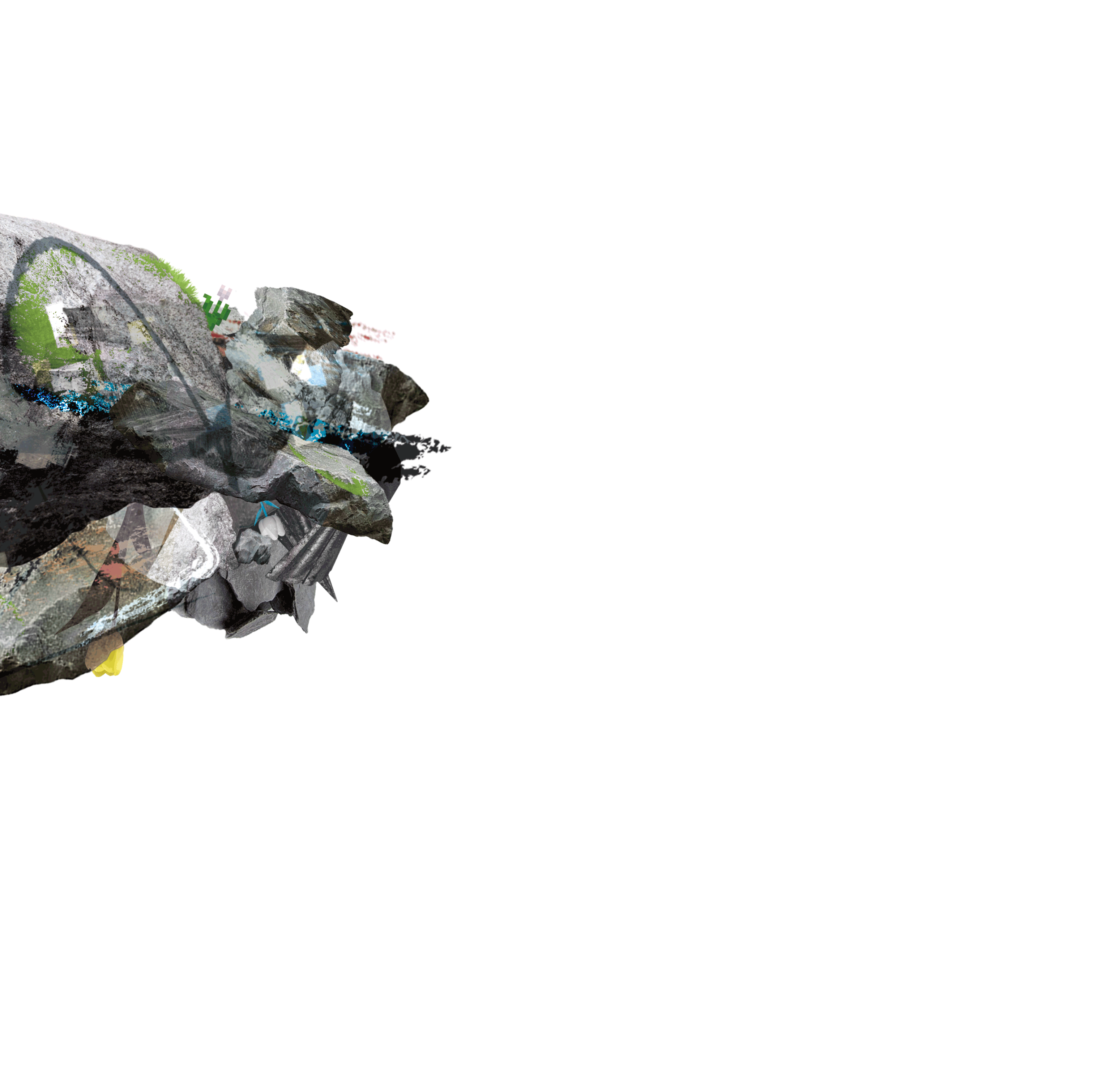
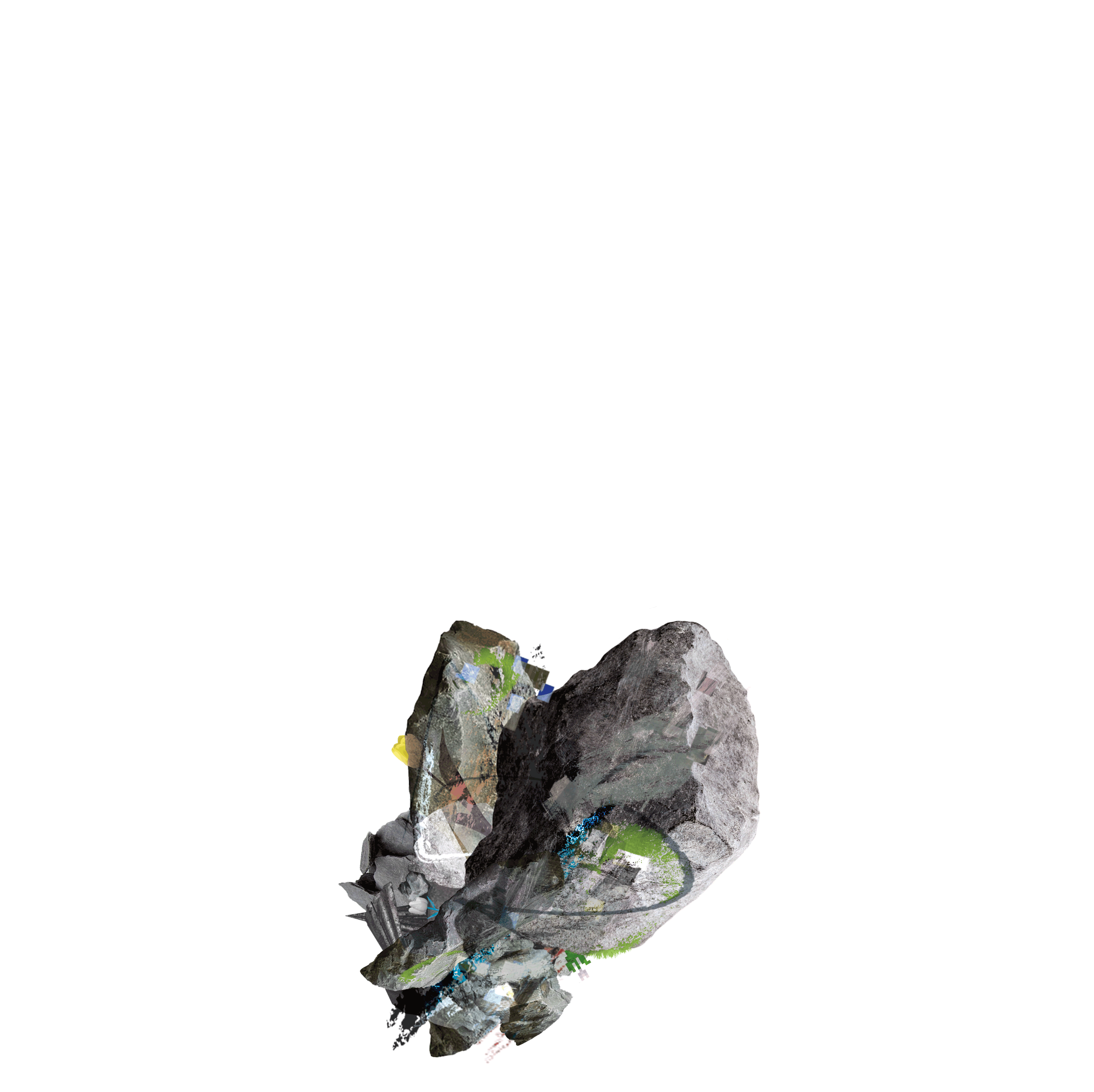
Möglichst viele Menschen für den Alpenschutz begeistern – das kann man nicht alleine: mountainwilderness.ch